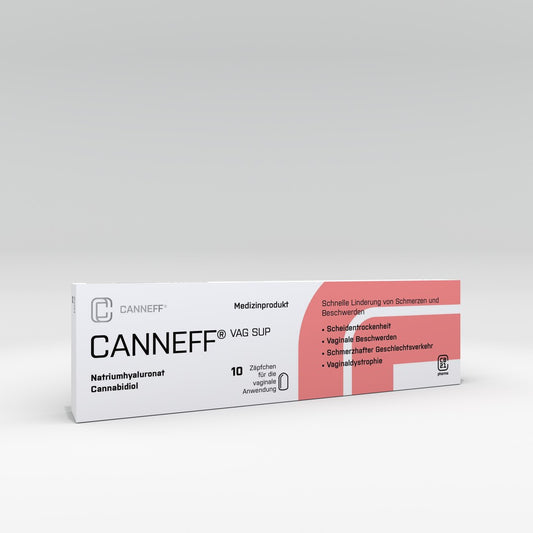Was sind die häufigsten Ursachen einer Scheidenentzündung?
Scheidenentzündungen entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel aus inneren und äußeren Faktoren. Die häufigsten Ursachen sind bakterielle oder mykotische Infektionen, ein gestörtes Scheidenmilieu sowie hormonelle Schwankungen – insbesondere in den Wechseljahren oder bei hormoneller Verhütung. Auch mechanische Reizungen, allergische Reaktionen oder systemische Erkrankungen wie Diabetes mellitus spielen eine Rolle. Das Gleichgewicht der Vaginalflora ist äußerst sensibel und kann bereits durch kleinere Störungen kippen, wodurch Krankheitserreger leichteres Spiel haben. Vor allem wiederkehrende Kolpitiden lassen sich oft auf eine Kombination mehrerer Ursachen zurückführen.
|
Hauptursachen der Kolpitis |
Beispiele / Einflussfaktoren |
|
Mikrobielle Infektionen |
Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Trichomonaden |
|
Hormonelle Veränderungen |
Menopause, Schwangerschaft, Pubertät, hormonelle Verhütung |
|
Milieuverschiebungen |
pH-Wert über 4,5, Reduktion der Laktobazillen |
|
Mechanische Reizungen |
Tampons, Diaphragma, Spirale, Geschlechtsverkehr |
|
Übertriebene Hygiene |
Intimsprays, Scheidenspülungen, alkalische Seifen |
|
Systemische Erkrankungen |
Diabetes mellitus, Eisenmangel, Immunschwäche |
|
Medikamente |
Antibiotika, Kortikosteroide, Chemotherapeutika |

Wie entsteht eine Kolpitis durch Bakterien oder Pilze?
Kolpitiden durch Bakterien oder Pilze entstehen, wenn das empfindliche Gleichgewicht der Scheidenflora gestört ist. Unter normalen Bedingungen sorgen Milchsäurebakterien für ein saures Milieu (pH 3,8–4,5), das pathogene Keime verdrängt. Gerät diese Balance ins Wanken – etwa durch Antibiotika, Hormonschwankungen oder Hygieneprodukte – können sich pathogene Erreger ansiedeln und vermehren. Typische bakterielle Erreger sind Gardnerella vaginalis, Chlamydien oder Mykoplasmen, während bei Pilzinfektionen meist Candida albicans im Vordergrund steht. Der Auslöser kann sowohl von außen eingeschleppt als auch endogen durch eine Überbesiedelung körpereigener Keime entstehen.
Kann übertriebene Intimhygiene eine Vaginitis auslösen?
Tatsächlich gilt übertriebene Intimhygiene als eine der häufigsten vermeidbaren Ursachen einer Vaginitis. Produkte wie Intimdeos, alkalische Seifen, parfümierte Waschgels oder Scheidenspülungen zerstören die natürliche Schutzbarriere der Vagina, indem sie die Milchsäurebakterien reduzieren und den pH-Wert erhöhen. Dadurch können sich krankmachende Keime leichter ausbreiten. Besonders problematisch ist es, wenn tägliche Waschungen mit aggressiven Produkten kombiniert werden. Auch der häufige Gebrauch von Feuchttüchern oder aggressivem Toilettenpapier kann die Schleimhaut reizen und Entzündungen begünstigen.
|
Intimhygiene & Risiko für Kolpitis |
Auswirkung auf das Scheidenmilieu |
|
Parfümierte Produkte |
Reizung, Allergien, Reduktion der Laktobazillen |
|
Alkalische Seifen |
pH-Anstieg, Verlust der Schutzflora |
|
Scheidenspülungen |
Auswaschen der physiologischen Bakterien |
|
Intimsprays / Deos |
Kontaktdermatitis, Schleimhautreizung |

Welche Rolle spielt der pH-Wert bei der Entstehung einer Kolpitis?
Der pH-Wert der Scheide ist ein zentraler Faktor für die vaginale Gesundheit. Ein saurer pH-Wert zwischen 3,8 und 4,5 verhindert die Ansiedlung von Bakterien und Pilzen. Wird dieser Wert überschritten, etwa durch Blut, Sperma, Seife oder hormonelle Veränderungen, geraten die Laktobazillen in Bedrängnis. In der Folge dominiert eine alkalische Umgebung, in der sich Keime wie Gardnerella vaginalis oder Candida albicans ungehindert ausbreiten können. Der pH-Wert ist daher nicht nur ein Indikator für Infektionen, sondern auch ein Schlüsselfaktor in der Prävention.
|
pH-Wert der Scheide |
Zustand der Flora |
Infektionsrisiko |
|
3,8–4,5 (sauer) |
Gesunde Laktobazillenflora |
Niedrig |
|
>4,5 (alkalisch) |
Gestörtes Milieu, weniger Milchsäurebakterien |
Hoch bei bakterieller Vaginose |
Wie wirken sich hormonelle Veränderungen auf die Scheidenflora aus?
Hormonelle Schwankungen haben einen direkten Einfluss auf die Struktur und Funktion der Vaginalschleimhaut. Vor allem Östrogen fördert die Dicke der Schleimhaut, erhöht die Zuckerproduktion und unterstützt die Besiedlung mit Laktobazillen. In Phasen niedriger Östrogenspiegel – etwa während der Menopause, Stillzeit oder Einnahme hormonfreier Verhütungsmittel – nimmt die vaginale Resistenz ab. Die Schleimhaut wird dünner, trockener und anfälliger für Mikroverletzungen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Milchsäurebakterien, was den pH-Wert steigen lässt und die Besiedlung durch pathogene Keime erleichtert.
Können Medikamente wie Antibiotika eine Kolpitis verursachen?
Ja, insbesondere breitbandige Antibiotika zählen zu den häufigsten iatrogenen (medikamentös verursachten) Auslösern einer Kolpitis. Sie zerstören nicht nur krankmachende Bakterien, sondern auch die nützlichen Laktobazillen in der Scheidenflora. In der Folge können sich Hefepilze wie Candida albicans ungehindert vermehren – eine sogenannte sekundäre mykotische Kolpitis ist die Folge. Auch Kortikosteroide, Chemotherapeutika oder Immunsuppressiva können das vaginale Gleichgewicht stören, indem sie die lokale Immunabwehr schwächen.
|
Medikament |
Wirkung auf die Scheidenflora |
Mögliche Folge |
|
Antibiotika |
Reduktion der Laktobazillen |
Pilzinfektion (Candida) |
|
Kortikosteroide |
Schwächung des Immunsystems |
Rezidivierende Infektionen |
|
Chemotherapeutika |
Schleimhautschädigung, Immunsuppression |
Atrophische Kolpitis |
Welche Rolle spielen Tampons, Spiralen oder Diaphragmen?
Mechanische Reize durch Tampons, Spiralen oder Diaphragmen können die vaginale Schleimhaut irritieren und zu Mikroverletzungen führen, die das Eindringen von Erregern erleichtern. Besonders wenn Tampons zu lange getragen werden oder eine vergessene Menstruationshygiene vorliegt, entsteht ein feuchtwarmes Milieu, in dem sich Bakterien schnell vermehren. Auch das Diaphragma kann bei unsachgemäßer Anwendung zu lokalen Reizungen führen. Spiralen wiederum verändern durch ihre dauerhafte Präsenz im Uterus das vaginale Milieu – insbesondere Kupferspiralen können Entzündungsprozesse begünstigen.
Ist Stress ein unterschätzter Risikofaktor für Vaginalinfektionen?
Chronischer Stress beeinträchtigt das Immunsystem – auch auf Schleimhautebene. Studien zeigen, dass psychosozialer Stress mit einer höheren Anfälligkeit für vaginale Infektionen einhergeht. Der Grund: Stresshormone wie Cortisol wirken immunsuppressiv, verändern die Schleimhautbarriere und stören das bakterielle Gleichgewicht. Frauen mit hoher mentaler Belastung leiden häufiger an wiederkehrender Vaginitis, insbesondere wenn gleichzeitig hormonelle Dysbalancen, Schlafmangel oder eine unausgewogene Ernährung vorliegen. Insofern ist Stressmanagement ein bedeutender – aber oft unterschätzter – Baustein in der Prävention und Therapie.

Kann Diabetes die Entstehung einer Scheidenentzündung begünstigen?
Frauen mit Diabetes mellitus haben ein signifikant erhöhtes Risiko für Scheidenentzündungen. Der Grund liegt im erhöhten Blutzuckerspiegel, der sowohl das Immunsystem schwächt als auch die Zuckerverfügbarkeit in der Schleimhaut erhöht – ideale Bedingungen für das Wachstum von Hefepilzen. Hinzu kommt, dass bei schlecht eingestelltem Diabetes die Wundheilung verzögert ist, was lokale Entzündungen begünstigt. Studien zeigen, dass besonders Pilzinfektionen wie Candidosen bei Diabetikerinnen häufiger und hartnäckiger verlaufen als bei stoffwechselgesunden Frauen.
Warum kommt es bei Mädchen und älteren Frauen häufiger zu Kolpitis?
Sowohl Mädchen vor der Pubertät als auch Frauen nach den Wechseljahren sind besonders anfällig für Kolpitis, weil in beiden Lebensphasen der Östrogenspiegel niedrig ist. Dadurch ist die Vaginalschleimhaut dünn, trocken und nicht durch Laktobazillen geschützt. Bei Kindern kommt hinzu, dass das Scheidenmilieu neutral (pH 7) ist, was die Vermehrung von Keimen aus dem Analbereich erleichtert – häufig durch unsachgemäße Hygiene. Bei älteren Frauen führt der Hormonmangel zu atrophischen Veränderungen, die die Schleimhaut verletzlicher machen. Das Zusammenspiel aus trockener Schleimhaut, erhöhtem pH-Wert und verminderter Immunabwehr erklärt die höhere Inzidenz von Kolpitis in diesen Altersgruppen.